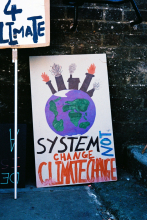In vielen Ländern verdienen Frauen weniger als Männer und sind seltener in Führungspositionen zu finden. Da in der Praxis Entscheidungen über Gehälter und die Karriere oftmals verhandelt werden, greifen wir auf die Verhandlungsforschung zurück, um diese Ungleichheiten zu erklären. Wir betrachten u. a., ob Frauen seltener Verhandlungen führen als Männer, ob sie schlechter in Verhandlungen abschneiden und warum Geschlechtsunterschiede in Verhandlungen entstehen.
„Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle unzufrieden sind“ – so der französische Politiker und Friedensnobelpreisträger Aristide Briand (1862-1932). Sind Kompromisse nicht etwas Gutes? – Von klein auf werden wir zu Kompromissen angehalten und für gütliche Einigungen gibt es scheinbar keine Alternative. Oder doch? Ein Kompromiss bedeutet, dass alle Zugeständnisse machen müssen – das kann geradezu schmerzhaft sein. Daher steckt in der Aussage von Briand ein wahrer Kern. Ist der Kompromiss trotzdem die bestmögliche Lösung? Die Forschung spricht dagegen: Kompromisse führen häufig zu suboptimalen Lösungen. In den meisten Verhandlungen gibt es eine für alle Parteien bessere Lösung. Warum lassen wir uns dann mit faulen Kompromissen abspeisen? – Weil der Mehrwert oft versteckt ist und es Strategien braucht, ihn zu finden.
Verhandlungen sind allgegenwärtig: Ein Blick in die Tagesmedien verdeutlicht, welchen zentralen Stellenwert Verhandlungen in unserer Gesellschaft haben. Es wird über Tarifverträge, Koalitionsvereinbarungen, den EU-Beitritt von Ländern, den Militär-Einsatz in internationalen Konflikten, über Förderpakete in der Euro-Krise, die Zukunft einer insolventen Bank oder Firma, die Sinnhaftigkeit eines Bahnhofsausbaus, den Verbleib eines Ministers oder auch über den deutschen Beitrag im europäischen Fiskalpakt verhandelt.
Ob Förderpakete im Rahmen der griechischen Finanzkrise, Einigungsversuche zwischen Tarifvertragsparteien oder der Verkauf einer industriellen Großanlage – wenn der Ausgang einer Verhandlung von besonderer Bedeutung für die beteiligten Parteien und der Weg zur Einigung vermeintlich schwierig ist, werden in der Regel Teams zum Verhandlungstisch geschickt. Aber lässt sich dieses Vorgehen durch Leistungsdaten rechtfertigen? Verhandeln Teams also tatsächlich besser? Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den nützlichen und schädlichen Effekten, die auftreten, wenn Verhandlungen zwischen Teams statt zwischen Einzelpersonen stattfinden.
Stellen Sie sich Angela Merkel in einer Verhandlung mit Nordeuropäischen Führungspersönlichkeiten vor, alle sind Männer. Jetzt stellen Sie sich vor wie sie mit Südeuropäischen Repräsentanten über finanzielle Abhilfe diskutiert. In der ersten Situation ist es wahrscheinlicher, dass sie als Frau wahrgenommen wird; in der zweiten eher als Nordeuropäische Politikerin. Dieser Artikel untersucht wie der Kontext die Wahrnehmung und das Verhalten von Verhandlungen beeinflusst.