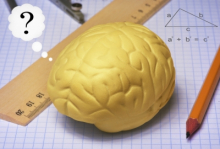Wissen Sie, wie viel Zeit Sie täglich mit Medien verbringen? Sei es nun die Reklame auf dem Bus, die Whatsapp-Nachricht auf dem Smartphone, die Musik im Einkaufszentrum oder die neue Ausgabe des In-Mind Magazins – Medien umgeben uns alltäglich. Gerade durch die Zunahme der sogenannten interaktiven Medien wie Computer oder Handy wird so gut wie jeder Teil des Lebens in der westlichen Welt durch Medien begleitet. Da bleibt die Frage nicht aus, inwiefern uns Medien und ihre Inhalte beeinflussen.
Macht Gewalt in Computerspielen aggressiv? Die Kontroverse um die Wirkung von Gewalt in Computerspielen beschäftigt Wissenschaft und Öffentlichkeit seit über 25 Jahren. Trotzdem ist die Befundlage weiterhin uneinheitlich. Verantwortlich sind dafür neben methodischen Problemen auch ideologische Überzeugungen der Beteiligten. In unserem Überblicksartikel fassen wir zusammen, welche Erkenntnissen die Forschung bislang geliefert hat und welche Fragen immer noch unbeantwortet sind. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die teilweise alarmistischen Warnungen vor schädlichen Auswirkungen nicht hinreichend von den wissenschaftlichen Befunden gestützt werden.
Was tun Menschen, um sich von den Belastungen des Alltags zu erholen, und welche Rolle können Medien dabei spielen? Die Forschung zu Erholung durch Medien legt nahe, dass Medieninhalte keineswegs, wie häufig postuliert, nur negative Wirkungen haben.
Digitale Medien sind zu unseren ständigen Begleitern geworden. Sowohl in der Freizeitgestaltung als auch im Berufsleben und im (Hoch-)Schulalltag nehmen digitale Medien in Form von Smartphones, Laptops und Tablet-PCs eine zentrale Rolle ein. Im (Hoch-)Schulalltag werden digitale Medien jedoch meist eher als Ablenkung denn als sinnvolles Instrument für die Wissensvermittlung betrachtet. Ist dieser schlechte Ruf berechtigt? Oder bieten digitale Medien auch neue Chancen für effektives Lernen? Dieser Artikel versucht (durch Abwägung von Potenzialen und Risiken), hierauf eine Antwort zu finden.
Im Oktober 2013 wurde in der Europäischen Union beschlossen, dass abschreckende Bilder als Warnhinweise auf Zigarettenschachteln abzudrucken sind. Als Massenmedium erreichen diese viele Menschen, aber sind sie auch wirksam? Bei dieser Art von Medium wird außer Acht gelassen, dass Raucher sehr individuell auf solche Konfrontationen reagieren, was sich in widersprüchlichen Forschungsergebnissen zeigt. Wie kommen diese unterschiedlichen Ergebnisse zustande? Welche Maßnahmen können zu einer Erhöhung der Wirksamkeit der Warnhinweise führen? Welche Informationen fehlen in den Warnhinweisen, um gegenteilige Wirkungen zu vermeiden?